„Open Arms“ oder „Closed Doors“ – Wer gehört (wirklich) in den Maßregelvollzug?
Die Gegenüberstellung im Titel bringt auf den Punkt, worum es bei den diesjährigen Forensiktagen geht: Zwischen Offenheit und Abgrenzung, zwischen Behandlungsauftrag und Systemgrenzen stellt sich zunehmend die Frage, wer im Maßregelvollzug (noch) richtig aufgehoben ist – und wer nicht.
Veranstaltungsinformationen
Montag, 3. November, 8.30 - 16 Uhr
Dienstag, 4. November, 9.15 - 16.15 Uhr
Konferenzzentrum der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach, Vulkanstraße 58, 56626 Andernach
Teilnahmebeitrag inkl. Tagesverpflegung:
199 EUR (zzgl. MwSt.) für beide Tage
104 EUR (zzgl. MwSt.) für einen Tag
Teilnahme Abendveranstaltung:
35 EUR exkl. Getränke (inkl. MwSt.)
Neue gesetzliche Vorgaben, komplexe Fallkonstellationen und gesellschaftliche Erwartungen fordern uns heraus: Wie gehen wir mit Menschen ohne gesicherte Aufenthaltsperspektive um? Wie beurteilen wir Therapieprognosen nach der Reform des § 64 StGB und wie können wir unsere Lockerungsprognosen verbessern? Wie schaffen wir es, Resozialisierung tatsächlich umzusetzen – trotz knapper Ressourcen und begrenzter Anschlussmöglichkeiten? Und wie ist in diesem Konglomerat die medial gehäuft dargestellte Messergewalt in Deutschland einzuordnen?
Auch in diesem Jahr können Sie sich wieder auf aktuelle Themen freuen – renommierte Fachleute werden zu den neuesten Entwicklungen in der Forensik referieren. Gemeinsam wollen wir diskutieren, reflektieren und neue Perspektiven entwickeln.
Neben dem fachlichen Diskurs erwartet Sie am Montagabend ein besonderes Highlight. Wir besuchen das ehrwürdigen Kloster Maria Laach – inklusive seiner beeindruckenden, alten Bibliothek, die Erinnerungen an Harry Potter weckt und mit ihrem historischen Flair begeistert. Anschließend genießen wir gemeinsam ein Abendessen in der gemütlichen Klostergaststätte – ein Abend voller Genuss und Austausch in einmaliger Atmosphäre.
Wir freuen uns darauf, Sie bei unseren 19. Forensiktagen der Klinik Nette Gut am 3. und 4. November 2025 im Konferenzzentrum der Rhein-Mosel-Akademie in Andernach zu begrüßen.
Hinweis
Die Forensiktage 2025 sind ausgebucht. Wir bitten um Verständnis, dass keine weiteren Anmeldungen mehr angenommen werden können.
Programm 3. November
8.30 Uhr - Check-in
9 Uhr
- Begrüßung - Dr. Alexander Wilhelm, Geschäftsführer Landeskrankenhaus (AöR)
- Grußworte
- Musikalische Begleitung - Patientenband der Klinik Nette-Gut
- Moderation - Sonja Dette
Der Vortrag soll Einblicke in das Thema „Aufenthaltsbeendigung“ geben und dabei insbesondere die Thematik Abschiebung von (Intensiv-)Straftäter:innen aus dem Maßregelvollzug beleuchten.
Was unterscheidet die Abschiebung von der Ausweisung? Was sind die rechtlichen Voraussetzungen für eine Abschiebung? Welche Rechtsschutzmöglichkeiten hat die betroffene Person und welche Abschiebungshindernisse stehen der Durchführung der Abschiebung entgegen?
Mit diesen Fragen werden wir uns beschäftigen und dabei insbesondere Abschiebungsverbote aus gesundheitlichen Gründen und die Beurteilung der Reisefähigkeit im Rahmen einer Abschiebung in den Blick nehmen.

Sven Adamczewski war nach seinem Studium im allgemeinen Ausländer- sowie Asylrecht tätig, bis er sich im Jahr 2016 auf den Bereich Rückführung spezialisierte. In seiner Funktion als Teamleiter war er für allgemeines Ausländerrecht und den Bereich Aufenthaltsbeendigung zuständig. Nach einer zweijährigen Zwischenstation bei der Aufsichtsbehörde ist er nunmehr Leiter der Ausländerbehörde, der Einbürgerungsbehörde und der Jagd- und Waffenbehörde. Sven Adamczewski ist zudem seit mehreren Jahren als Lehrbeauftragter für Ausländerrecht an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz tätig. Weiterhin hält er bei der Polizei der Länder und bei Verwaltungen regelmäßig Vorträge im Ausländerrecht, insbesondere in den Bereichen der Grundlagenvermittlung und der Aufenthaltsbeendigung. Bei seiner Lehrtätigkeit ist ihm insbesondere die praxisnahe Vermittlung von ausländerrechtlichen Kenntnissen sowie die Einbringung von Fallbeispielen wichtig.
Der Vortrag gibt einen Überblick über die aktuelle Evidenzlage und beschäftigt sich mit den Ergebnissen einer aktuellen Studie, die untersucht, welche psychiatrischen, sozialen, kriminologischen sowie persönlichkeitsbezogenen Faktoren den Erfolg oder Misserfolg einer Maßregelvollzugsbehandlung gem. § 64 StGB beeinflussen.

Dr. Michael Fritz studierte Philosophie und Psychologie an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Österreich. Parallel dazu war er in sozialtherapeutischen Einrichtungen tätig, arbeitete hier mit Kindern und Jugendlichen mit Störungen des Sozialverhaltens sowie mit langzeitdrogenabhängigen Menschen.
Mit Beginn seines Doktorats wechselte er in die Experimentelle Psychiatrie und widmete sich der präklinischen neurowissenschaftlichen Forschung. Seine Promotion schloss er mit Auszeichnung ab und arbeitete im Anschluss an der Abteilung für Experimentelle Medizin der Universität Linköping (Schweden), übernahm dort eine Assistenzprofessur am Zentrum für Soziale und Affektive Neurowissenschaften und absolvierte Forschungsaufenthalte an der Johns-Hopkins-Universität sowie am National Institute on Drug Abuse in Baltimore (USA). Es folgte eine zweijährige Gastdozentur an der Abteilung für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften der Stanford University in Kalifornien.
Nach seiner Rückkehr nach Europa war Dr. Fritz als Psychologe an der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Ulm am BKH Günzburg tätig. Dort übernahm er auch die Leitung der Forschungssektion für Molekulare Genetik und Forensische Verhaltenswissenschaften. Von 2022 bis 2024 folgte er dem Ruf auf eine W2-Professur für Psychologie an der AKAD University of Applied Sciences, wo er zusätzlich den Bachelorstudiengang Psychologie designte, akkreditierte und später leitete. Ende 2024 kehrte er als stellvertretender therapeutischer Direktor an die Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Günzburg zurück.
Dr. Fritz ist Fachpsychologe für Rechtspsychologie (BDP/DGPs), Autor von über 30 wissenschaftlichen Publikationen (Forschungs-, Übersichts- und Buchbeiträge) und als Gutachter in den Bereichen Schuldfähigkeit, Kriminalprognose und Waffenrecht tätig.
„Wer keine üblen Gewohnheiten hat, hat wahrscheinlich auch keine Persönlichkeit.“ (William Faulkner)
Persönlichkeitsstörungen können diagnostiziert und behandelt werden. Was aber, wenn die Grenze zur Persönlichkeitsstörung nicht überschritten ist, die vorliegenden Akzentuierungen oder psychopathische Züge aber die Behandlung einer anderen Grunderkrankung erschweren? Wie behandelt man Komorbiditäten und wie geht man im therapeutischen Alltag mit den die Therapieprozesse störenden Persönlichkeitsbesonderheiten um?
Im Vortrag soll hierzu ein Überblick gegeben werden.

Michaela Schwarz ist Dipl.-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin und Rechtspsychologin. Nach praktischer Tätigkeit in der Allgemeinpsychiatrie wechselte sie 2008 in die Klinik Nette-Gut für Forensische Psychiatrie, wo sie seit 2020 als leitende Psychotherapeutin tätig ist. Zudem arbeitet Michaela Schwarz als psychologische Sachverständige für Staatsanwaltschaften und Gerichte.
Die Kommunikation von Risiken gehört zu den zentralen Aufgaben der forensischen Psychiatrie und nimmt Einfluss auf die richterliche Entscheidungsfindung – insbesondere im Spannungsfeld zwischen öffentlicher Sicherheit, Patient:innenrechten und professioneller Verantwortung kommt ihr eine hohe Bedeutung zu. Im Vortrag werden wissenschaftlich fundierte Modelle der Risikokommunikation vorgestellt und im Hinblick auf ihre Anwendung in forensisch-psychiatrischen Kontexten kritisch bewertet. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie Risikoeinschätzungen gegenüber allen Beteiligten transparent, verständlich und verantwortungsvoll vermittelt werden können.

Sharon Schumann ist Psychologin M. Sc., Psychologische Psychotherapeutin (VT) und leitet die Psychotherapeutischen Fachambulanzen für Gewalt- und Sexualstraftäter in München, Landshut und Memmingen. Nach langjähriger, im Verlauf leitender Tätigkeit in der stationären Maßregelvollzugsbehandlung in verschiedenen bayerischen Kliniken, begann sie 2022 in der Fachambulanz. Zusätzlich führt Sie eine psychotherapeutische Privatpraxis und ist als Supervisorin sowie Sachverständige in der Schuldfähigkeits- und Prognosebegutachtung tätig.
- AUSGEBUCHT - Gutachtenseminar - Grundlagen der Kriminalprognose - AUSGEBUCHT -
Sie interessieren sich für gutachterliche Tätigkeit? In diesem zweitägigen Seminar erhalten Sie einen ersten Einblick in die wesentlichen Grundlagen und Methoden zur fundierten Erstellung von Kriminalprognosen. Sie erhalten einen Überblick über die rechtlichen Anforderungen, die Methodik sowie die verschiedenen Prognoseansätze. Ein Besonderer Fokus liegt auf der sachgerechten Datenerhebung und der Analyse von Risikofaktoren, die anhand eines praktischen Beispiels erarbeitet werden. Ziel des Seminars wird es sein, den Teilnehmenden Sicherheit in der Entscheidungsfindung zu vermitteln, indem sie in Grundzügen lernen, objektive und nachvollziehbare Prognosen zu erstellen.
Wichtiger Hinweis: Das Seminar richtet sich an Psycholog:innen und Ärzt:innen, die einen ersten Einblick in die gutachterliche Tätigkeit im Strafrecht erhalten möchten. Die Teilnehmendenzahl dieses Seminars ist auf 20 Personen limitiert. Teilnehmende, die das Gutachtenseminar buchen, sind automatisch für die Seminarteilnahme an beiden Tagen angemeldet. Eine Teilnahme an nur einem der Seminartage ist nicht möglich.
Bitte beachten Sie: Dieses Seminar ist bereits ausgebucht.

Liba Ivankova ist Dipl.-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin und Fachpsychologin für Rechtspsychologie (BDP/DGPs). Nach zehnjähriger psychotherapeutischen Tätigkeit in der privaten Suchtklinik Bad Tönisstein für erwachsene alkohol- und medikamentenabhängige Patient:innen, nahm sie 1999 ihre Arbeit in der Klinik Nette-Gut für Forensische Psychiatrie auf. Zunächst arbeitete sie in der Patientenversorgung, bevor sie in das Gutachteninstitut der Klinik Nette-Gut wechselte – hier ist sie seit nunmehr 14 Jahren als psychologische Sachverständige im Strafrecht tätig.

Dr. Regina Mayr-Erlinger ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Nach ihrem Medizinstudium und der Promotion an der Universität Tübingen absolvierte sie ihre Facharztausbildung an der Uniklinik Tübingen. Dort war sie in Forschung, Klinik und Lehre tätig, mit Schwerpunkt im Suchtbereich, der Gutachtenstelle sowie in der forensisch-psychiatrischen Ambulanz. Zudem ist sie als psychiatrische Sachverständige im Strafrecht tätig. Seit 2024 ist sie als leitende Oberärztin in einer suchtherapeutischen Abteilung der Klinik Nette-Gut für Forensische Psychiatrie beschäftigt.

- AUSGEBUCHT - Seminar 1 - Zwischen Ausreisepflicht und Resozialisierung: Der forensische Umgang mit ungesichertem Aufenthaltsstatus - AUSGEBUCHT -
Sven Adamczewski
Im Vertiefungsseminar findet bei interaktiver Gestaltung eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Inhalten des Vortrags statt.
Bitte beachten Sie: Dieses Seminar ist bereits ausgebucht.

- AUSGEBUCHT - Seminar 2 - Von klinischem Bauchgefühl bis Evidenzbasierung – Welche Faktoren spielen eine tatsächliche Rolle hinsichtlich eines Behandlungserfolges einer Suchtbehandlung im Maßregelvollzug und wohin soll die Reise gehen? - AUSGEBUCHT -
Dr. Michael Fritz
Aufbauend auf dem Vortrag werden im Vertiefungsseminar weitere innovative Aspekte sowie laufende Studien vorgestellt, die das Potenzial haben, den Weg zu einer patient:innenzentrierten und modernen Behandlung suchtkranker Straftäter:innen zu ebnen. In der zweiten Hälfte ist vorgesehen, ein Forum zu schaffen, in dem Endnutzende – wie Behandler:innen sowie Gutachter:innen – die Möglichkeit erhalten, Ideen und Fragen zu Aspekten ihrer praktischen Arbeit einzubringen. Ziel ist es, Themen zu identifizieren, deren systematische Untersuchung zur Qualitätsverbesserung im beruflichen Alltag beitragen könnte.
Bitte beachten Sie: Dieses Seminar ist bereits ausgebucht.

- AUSGEBUCHT - Seminar 3 - „Mords Molly“ – zum Umgang mit besonderen Persönlichkeitsstilen - AUSGEBUCHT -
Michaela Schwarz
Im Seminar findet eine Vertiefung statt, bei der anhand praktischer Fälle die berufsgruppenübergreifenden Perspektiven und Ansatzmöglichkeiten integriert und eingeübt werden.
Bitte beachten Sie: Dieses Seminar ist bereits ausgebucht.

Seminar 4 - Risikokommunikation - evidenzbasierte Reflexion unterschiedlicher Modelle
Sharon Schumann
Im Seminar findet eine vertiefte, praxisnahe Auseinandersetzung mit den Vortragsinhalten sowie insbesondere dem Fünf-Kategorien-Modell statt – anhand interaktiver und praktischer Arbeit sollen erste Skills vermittelt werden.

Seminaralternative - Führung
Für Tagungsteilnehmende, die anstelle eines Seminars lieber die Klinik Nette-Gut in Augenschein nehmen wollen, bieten wir eine Führung über das Klinikgelände an. Diese Führung ist aufgrund organisatorischer Gegebenheiten auf 2 x 15 Teilnehmende beschränkt.
Abendveranstaltung - AUSGEBUCHT -
--- Bitte beachten Sie: Die Abendveranstaltung ist bereits ausgebucht. ---
Wir besuchen das ehrwürdigen Kloster Maria Laach – inklusive seiner beeindruckenden, alten Bibliothek, die Erinnerungen an Harry Potter weckt und mit ihrem historischen Flair begeistert.
Anschließend genießen wir gemeinsam ein Abendessen in der gemütlichen Klostergaststätte – ein Abend voller Genuss und Austausch in einmaliger Atmosphäre.
Abfahrt ist um 16.20 Uhr vor der Akademie.
--- Bitte beachten Sie: Die Abendveranstaltung ist bereits ausgebucht. ---
Programm 4. November
- Begrüßung
- Musikalische Begleitung - Patientenband der Klinik Nette-Gut
- Moderation - Sonja Dette
Vorgestellt wird ein Kooperationsprojekt zwischen der Klinik Nette-Gut und den Universitäten Basel und Bonn, bei dem die Rolle der Therapeut:in-Patient:in-Beziehung im Maßregelvollzug untersucht werden soll. Ziel ist es, die Vorhersagekraft des Dual-Role Relationship Inventory-Revised (DRI-R; Skeem et al. 2007) für Regel- und Lockerungsverstöße zu überprüfen. Die Erhebung soll über mindestens ein Jahr hinweg sowohl an der Klinik-Nette-Gut wie auch an der Uniklinik Basel mit Patient:innen und Therapeut:innen erfolgen und durch Daten aus klinischen Systemen und Risikoassessments (u. a. START, SOAS-R, LIVELT) ergänzt werden. Erste methodische Herausforderungen (z. B. Erhebungszeitpunkte, Datenintegration) werden diskutiert. Der Beitrag bietet Einblicke in die Planungsphase und lädt zur kollegialen Diskussion über Studiendesign und praktische Umsetzung ein.

Dr. Barbara Bergmann studierte Psychologie an der Universität Kiel mit dem Schwerpunkt Rechtspsychologie und promovierte 2018 zum Thema „Expertise in der Kriminalprognose“. Sie war als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kriminologie der Universität Tübingen sowie am Lehrstuhl für Kriminologie und Strafrecht der Universität Mainz tätig. Seit 2023 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Sozial- und Rechtspsychologie an der Universität Bonn. In ihrer Forschung befasst sie sich u. a. mit Möglichkeiten der Vorhersage und der Prävention von delinquentem Verhalten.
Im Vortrag werden die besonderen Aufgaben und Herausforderungen gartentherapeutischer Angebote und Interventionen im Maßregelvollzug beleuchtet: Strukturen, Regelungen, Kommunikation, Sicherheitsbestimmungen, Gesetzgebung, enges interdisziplinäres Arbeiten – und nicht zuletzt die Pathologien und Komorbiditäten der Patient:innen sind stets zu beachten und in den therapeutischen Prozess einzubeziehen.
Trotz all der Besonderheiten und Herausforderungen dieses Settings zeigt es sich im therapeutischen Alltag immer wieder, wie wichtig und wertvoll ein (garten-)therapeutischer Naturkontakt für langzeituntergebrachte Patient:innen ist und wie effektiv solche gezielten Angebote einer Hospitalisierung und einem "hyper aging" entgegen wirken können.

Martin Pfannekuch ist Gärtner, FLL-zertifizierter Baumkontrolleur, Waldbauer, Arbeitstherapeut, Gartentherapeut IGGT und Dozent für arbeitstherapeutische Behandlungsverfahren an der ETS in Mainz. Er arbeitet seit mittlerweile fast 20 Jahren als Arbeits- und Gartentherapeut in der stationären Entwöhnungsbehandlung mehrfach drogenabhängiger erwachsener Männer und Frauen und in forensischen Psychiatrien. Seit mehreren Jahren ist Herr Pfannekuch als Referent und Praxisanleiter in der praktischen Ausbildung und Lehre im Bereich der Ergo- und Gartentherapie im In- und Ausland tätig.
„Langlieger“ in der Forensik - Neue Perspektiven schaffen
"Langlieger", also Patient:innen mit auch nach längerer Behandlungsdauer nicht absehbarer Entlassperspektive, stellen für den Maßregelvollzug eine große Herausforderung dar, da ihre Unterbringung und Behandlung oft mit professionellen, personellen und auch ethischen Problemen verbunden sind. Im Vortrag soll ein Versuch unternommen werden, diese Patient:innengruppe zu definieren und professionelle Rahmenbedingungen für sie abzustecken: Wer sind diese Patient:innen? Welche Ursachen gibt es für Langzeitunterbringungen? Gibt es valide abgrenzbare Subgruppen? Welche Herausforderungen müssen bewältigt werden? Welche Perspektiven können oder müssen realisiert werden?
Die Klinik Nette-Gut arbeitet aktuell intensiv an einem Konzept, das Antworten geben und Lösungen entwickeln soll. Erste Ansätze in anderen Kliniken zeigen, dass durch spezialisierte Therapieprogramme die besonderen Probleme dieser Patient:innen und ihrer Behandelnden adressiert und eigenständige Perspektiven geschaffen werden können. Diese ist natürlich auch von den zur Verfügung stehenden komplementären Versorgungseinrichtungen außerhalb des Maßregelvollzugs abhängig, die bzw. deren Schaffung in ein umfassendes Konzept eingebunden werden müssen.

Leonard Herff ist Arzt in Weiterbildung, zunächst in der Onkologie, seit 2019 in der Psychiatrie und Psychotherapie. Seit 2025 ist er als Funktionsoberarzt in der Klinik Nette-Gut für forensische Psychiatrie auf einer Station tätig, die überwiegend schizophrene Patienten betreut. Ein großer Teil seiner Patienten gehört zur Gruppe ohne längerfristige Entlassperspektive.
Tiergestützte Therapie im Maßregelvollzug
Die tiergestützte Therapie im Maßregelvollzug verbindet Wissenschaft und Menschlichkeit auf besondere Weise. Tiere wirken als Brücken zwischen Patient:innen und Therapeut:innen, fördern Vertrauen, Empathie und soziale Fähigkeiten. Studien belegen, dass der Umgang mit Hunden Aggressionen reduziert, Stress abbaut und die emotionale Stabilität verbessert. Gerade im hochregulierten Umfeld des Maßregelvollzugs ermöglichen Hunde eine besondere Form der Begegnung. Sie spiegeln Verhalten unmittelbar und ehrlich, was zum therapeutischen Prozess beitragen kann.
Wie sieht die Hundetherapie in der Praxis aus? Was lernen die Patient:innen von und mit den Hunden? Wie kann die Hundetherapie speziell im forensischen Kontext wirken und welche Ziele hat sie in Bezug auf das anschließende Leben in Freiheit?
Diese und andere Fragen sind Inhalte des Vortrags und des Vertiefungsseminars.

Stefanie Gleis ist Sozialpädagogin (BA), Tiergestützte Therapeutin und Tierphysiotherapeutin. Sie studierte Soziale Arbeit in Koblenz, wo sie ihr Praktikum unter anderem in der JVA Koblenz und als Schulsozialarbeiterin an der Realschule plus Kobern-Gondorf absolvierte. Seit 2013 ist sie selbstständig mit ihrer Firma „Therapiehundeteam Lebensfreu(n)de“ und arbeitet u. a. in der forensischen Klinik Nette-Gut, in der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach und im Berufsbildungswerk Heinrich-Haus. Sie hält Vorträge und führt Projekte im Bereich der Tiergestützten Therapie im Berufsförderungswerk Vallendar sowie an der Hochschule Koblenz durch. Bei ihrer Arbeit wird sie von ihren vier ausgebildeten Therapiehunden begleitet. Der fünfte Hund wird demnächst als Azubi das Team vervollständigen.
Hinter Mauern, vor Urteilen - Perspektivwechsel: Der Maßregelvollzug aus meiner Sicht als Patientin
Viele schauen auf den Maßregelvollzug, wenige kennen ihn von innen und selten bekommen diejenigen Gehör, die es vielleicht brauchen bzw. denen dieses dienen würde. Was hat im Maßregelvollzug rückblickend aus Patientinnensicht geholfen? Was wurde als hilfreich erlebt? Was wäre noch wichtig gewesen, hätte sie sich als ehemalige Patientin anders gewünscht? Diese und andere Fragen möchte Frau Franck adressieren.
Um die Unterbringung und Behandlung als persönliche Chance begreifen und nutzen zu können, ist eine informierte Entscheidung und sind im Folgenden Rahmenbedingungen erforderlich, die es ermöglichen, neue Perspektiven einzunehmen, positive Erfahrungen zu machen und persönliche Ziele zu finden. Diesen Weg von Beginn an zu unterstützen und Menschen auf ihrem individuellen Recovery-Weg zu begleiten, sieht sie als Aufgabe aller beteiligten Akteur:innen. Einige Beispiele aus der persönlichen Erfahrung auf diesem Weg möchte sie aus der Betroffenen-Perspektive vorstellen.

Claudia Franck wurde 1963 geboren und hat 1985 die Fachhochschulreife erlangt. Nach einem Aufenthalt im Maßregelvollzug qualifizierte sie sich 2012-2013 zur EX-IN-Genesungsbegleiterin, war als solche tätig und arbeitet heute als Trainerin für EX-IN-Kurse, ist Lehrbeauftragte der EX-IN-Akademie/EX-IN Deutschland e. V. (Trainerkurse). 2018 ließ sie sich zur Safewards-Trainerin ausbilden und unterstützt sei 2019 Einrichtungen bei der Implementierung von Safewards. Sie ist außerdem Autorin, bringt ihre Perspektive im Kontakt mit Fachkräften, bei Konferenzen, Fachtagungen und Trialogen ein. Ebenso engagiert sie sich in der Kriminal-, Gewalt- und Suchtprävention (Gefangene-helfen-Jugendlichen Hamburg, GhJ Team West, GhJ Team NRW Mitte e. V.).
- AUSGEBUCHT - Gutachtenseminar - Teil 2 - AUSGEBUCHT -
Aufbauend auf dem ersten Teil des Gutachtenseminars am 3. November erhalten die Teilnehmenden im zweiten Teil weitere Einblicke in die gutachterliche Tätigkeit. Da diese fachliche Sonderveranstaltung mehr Zeit in Anspruch nimmt, beginnt das Seminar bereits um 11.30 Uhr und wird in Form eines Brunchsymposiums abgehalten.
Wichtiger Hinweis: Teilnehmende, die das Gutachtenseminar am 1. Tag gebucht haben, sind automatisch für die Teilnahme am 2. Tag angemeldet. Eine Teilnahme an nur einem der Seminartage ist nicht möglich.
Bitte beachten Sie: Dieses Seminar ist bereits ausgebucht.
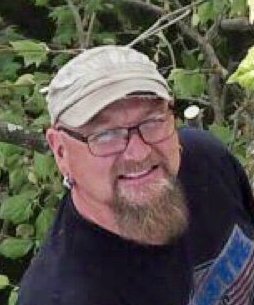
Seminar 1 - Gartentherapie im Maßregelvollzug – Chancen, Grenzen und Möglichkeiten naturgestützter Therapien im Setting einer forensischen Psychiatrie
Martin Pfannekuch
In dem Vertiefungsseminar zum Vortrag wird die Vielfalt der therapeutischen Arbeit anhand praktischer Übungen dargestellt. An unterschiedlichen Arbeitsstationen erfahren die Teilnehmenden die Wirkweise der verschiedenen gartentherapeutischen Interventionen.

- Ausgebucht - Seminar 2 - Messerkriminalität: Ursachen, Täter:innen, Motive - Ausgebucht -
Prof. Dr. Dirk Baier
Im Vertiefungsseminar werden die im Vortrag thematisierten Inhalte differenzierter ausgeführt, im Vortrag formulierte und weitere Annahmen geprüft.
Bitte beachten Sie: Dieses Seminar ist bereits ausgebucht.

Seminar 3 - Tiergestützte Therapie im Maßregelvollzug
Stefanie Gleis
Im Vertiefungsseminar werden hundetherapeutische Elemente praktisch angewendet und für die Teilnehmenden erfahrbar. Dabei besteht die Möglichkeiten, in den Austausch zu kommen und weitergehende Fragen zu klären.

- Ausgebucht - Seminar 4 - Verwendung des Impliziten und Expliziten Sexuelle Interessen Profils (EISIP) in der Forensischen Praxis - Ausgebucht -
Prof. Dr. Rainer Banse, Universität Bonn
Die Diagnostik von sexuellen Interessen ist einer der wenigen Bereiche in der Psychologie, in denen indirekte Messverfahren genutzt werden. In diesem Workshop wird ein kurzer Überblick über verschiedene physiologische und reaktionszeitbasierte Verfahren und ihre Möglichkeiten und Grenzen gegeben. Exemplarisch wird das Explizite und Implizite Sexuelle Interessen Profil (EISIP) vorgestellt. Neben Forschungsdaten zur Reliabilität und Validität wird die Nutzung des Verfahrens in der Einzelfalldiagnostik anhand von anschaulichen Falldaten vorgestellt. Im Workshop werden die spezifischen Probleme dieser Methodik (Wahrung der Testintegrität, Kommunikation der Testergebnisse, Verfälschbarkeit, Verwendung in Gutachten) diskutiert.
Prof. Dr. Rainer Banse studierte Psychologie an der Universität Gießen, wurde 1995 an der Universität Genf promoviert und habilitierte sich 2001 an der Humboldt Universität zu Berlin. Er war von 2003 bis 2007 Senior Lecturer an der University of York (GB) und ist seit 2007 Professor für Sozial- und Rechtspsychologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Sein Hauptforschungsinteresse liegt bei der Entwicklung und Validierung direkter und indirekter Messverfahren in verschiedenen Anwendungsfeldern von der sozialpsychologischen Grundlagenforschung bis zur forensischen Diagnostik. Seit 2013 leitet Rainer Banse einen berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengang M. Sc. Rechtspsychologie an der Universität Bonn.
Bitte beachten Sie: Dieses Seminar ist bereits ausgebucht.

- AUSGEBUCHT - Seminar 5 - Innovative Therapieansätze bei der Behandlung akustisch-verbaler Halluzinationen – auch etwas für die Forensik? - AUSGEBUCHT -
Prof. Dr. Dusan Hirjak
In dem vorgezogenen zugehörigen Vertiefungsseminar setzen sich die Teilnehmenden interaktiv und praxisnah mit den Therapieformen auseinander.
Bitte beachten Sie: Dieses Seminar ist bereits ausgebucht.
Akustisch-verbale Halluzinationen zählen zu den häufigsten und belastendsten Symptomen bei Schizophrenie und sind auch in der Forensik von hoher Relevanz. Neben bewährten medikamentösen und psychotherapeutischen Verfahren rücken zunehmend innovative Therapieformen in den Fokus – darunter auch virtuelle und avatarbasierte Ansätze. In diesem Vortrag werden aktuelle Entwicklungen in der Behandlung dieser Symptome, einschließlich der Forschungslage, vorgestellt und diskutiert. Im vorgezogenen zugehörigen Vertiefungsseminar setzen sich die Teilnehmenden interaktiv und praxisnah mit den Therapieformen auseinander.

Prof. Dr. Dusan Hirjak ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist geschäftsführender Oberarzt und Arbeitsgruppenleiter an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) Mannheim tätig. Zu seinen therapeutischen Schwerpunkten zählen insbesondere Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis sowie substanzinduzierte psychotische Erkrankungen. Wissenschaftlich beschäftigt er sich vor allem mit struktureller und funktioneller Bildgebung sowie der Erforschung neuronaler Korrelate psychopathologischer Symptome bei psychischen Erkrankungen.
Das Thema Messerkriminalität beschäftigt Deutschland mittlerweile seit einigen Jahren. Dabei existieren verschiedene Annahmen über die Messerkriminalität, so bspw., dass sie immer weiter zunimmt, dass sie insbesondere von ausländischen Tatpersonen ausgeführt wird und dass immer häufiger Messer aufgrund des zunehmenden Unsicherheitsgefühls mitgeführt werden.
Im Vortrag und der anschließenden Diskussion werden die vorhandenen nationale und internationale Forschungsbefunde zur Messerkriminalität vorgestellt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Darstellung der Formen und Einflussfaktoren dieses Verhaltens wie u. a. psychische Erkrankung. Zusätzlich werden vorhandene Präventionsmaßnahmen diskutiert. Im Vertiefungsseminar werden o. g. und weitere Annahmen geprüft.

Prof. Dr. Dirk Baier, Professor für Kriminologie an der Universität Zürich und Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Herr Baier hat Soziologie an der Technischen Universität Chemnitz studiert und danach zunächst als Wissenschaftlicher Mitarbeiter, später als stellvertretender Direktor am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen gearbeitet. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Jugenddelinquenz, Gewaltkriminalität und Extremismus.

Wir freuen uns darauf, Sie zu unseren nächsten Forensiktagen am 2. und 3. November 2026 zu begrüßen – Save the date!
Tagungsmanagement

Rhein-Mosel-Akademie
Institut für Fach- und Führungskräfte im Gesundheits- und Sozialwesen
Vulkanstraße 58 • 56626 Andernach
Maike Söller
Hinweis
Die Forensiktage 2025 sind ausgebucht. Wir bitten um Verständnis, dass keine weiteren Anmeldungen mehr angenommen werden können.
BUCHUNGSINFORMATIONEN
Zielgruppe: Die Veranstaltung richtet sich an Kolleginnen und Kollegen aller Berufsgruppen und Interessierte, die in ihrer täglichen Arbeit mit verhaltensauffälligen, psychisch erkrankten oder kriminellen Menschen zu tun haben.
Termin: Montag, 3. November, von 8.30 bis 16 Uhr und Dienstag, 4. November, von 9.15 bis 16.15 Uhr
Tagungsort: Konferenzzentrum der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach • Vulkanstraße 58 • 56626 Andernach
Anmeldefrist: Da nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen, bitten wir Sie, sich bis zum 14. Oktober anzumelden.
Bestätigung: Nach der verbindlichen Anmeldung wird Ihnen eine Anmeldebestätigung zugeschickt, die Sie bitte zu Beginn der Tagung vorlegen. (Urlaubsbedingt erfolgt eine Bestätigung der Anmeldung nach dem 17. September.)
Kosten: Der Teilnahmebeitrag für die Forensiktage 2025 beträgt inkl. Tagesverpflegung für beide Tage 199 € (zzgl. MwSt.), für einen Tag 104 € (zzgl. MwSt.). Der Kostenbeitrag für die Abendveranstaltung und das Abendessen am 4. November 2025 beträgt 35 € (inkl. MwSt.). Getränke sind selbst zu zahlen.
Akkreditierung: Die Akkreditierung der Veranstaltung ist bei der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz und der Bezirksärztekammer Koblenz beantragt.
Unterkünfte: Das ausführliche Gastgebendenverzeichnis der Stadt Andernach finden Sie auch unter andernach-tourismus.de.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Rhein-Mosel-Akademie.



